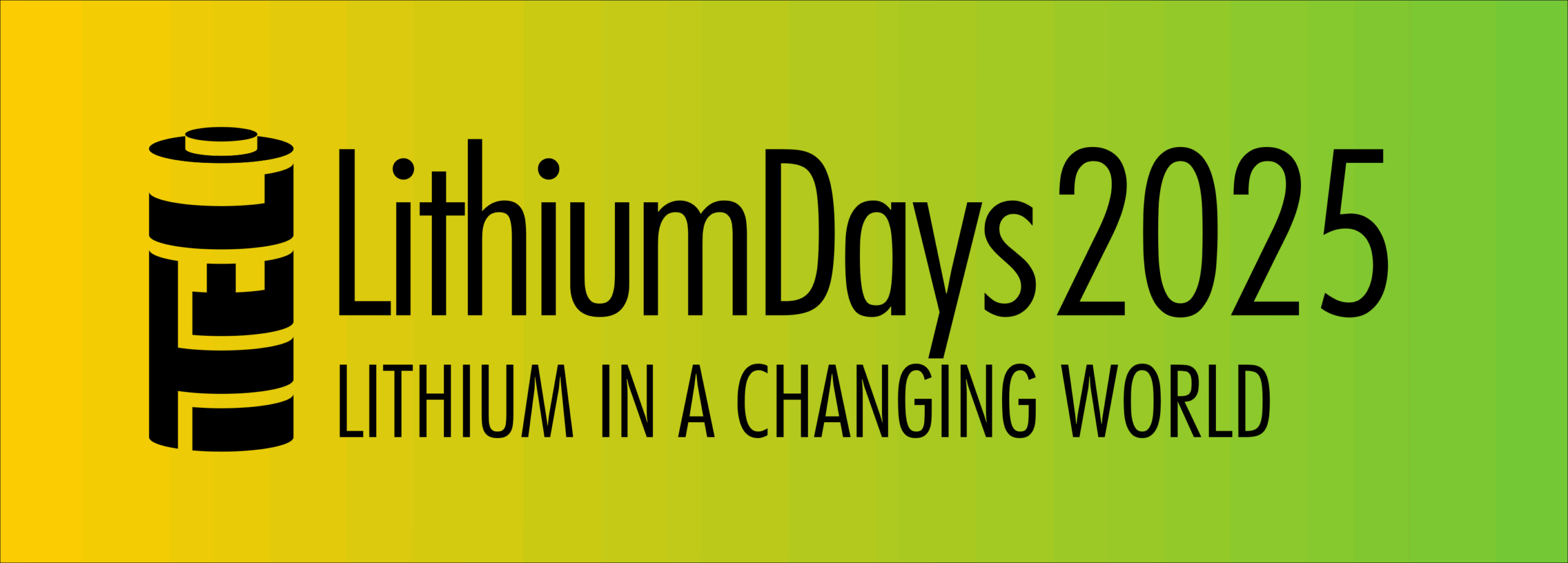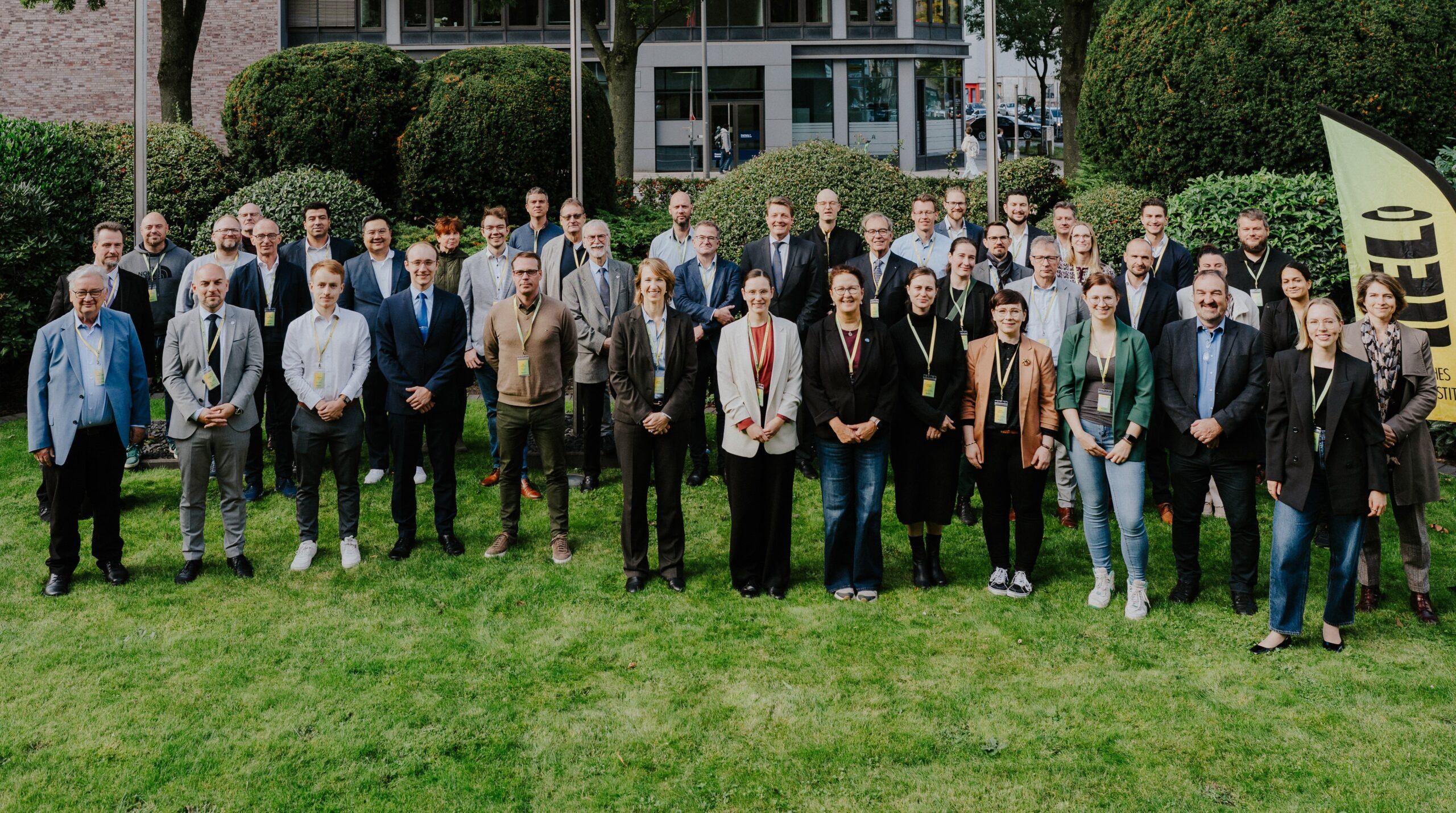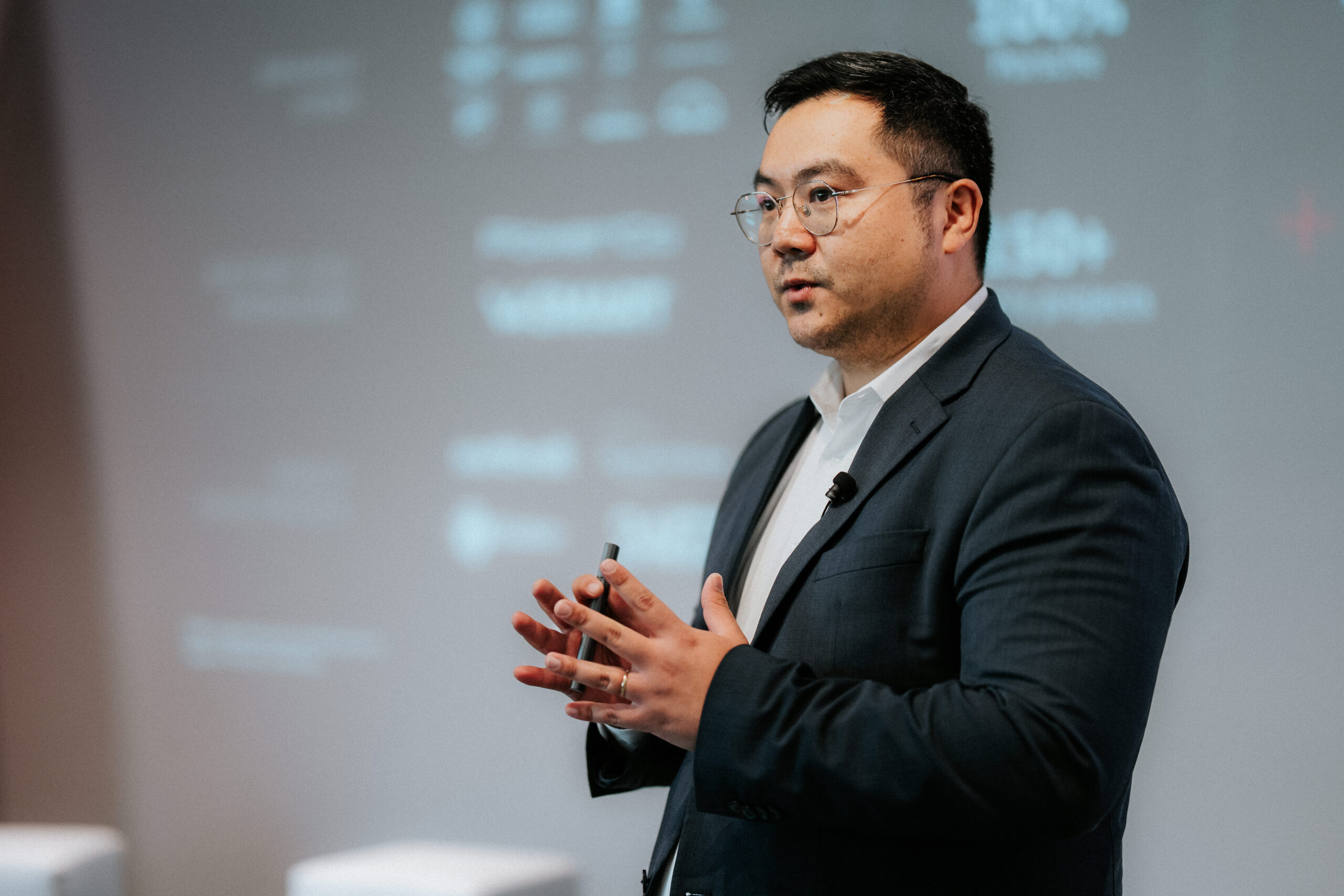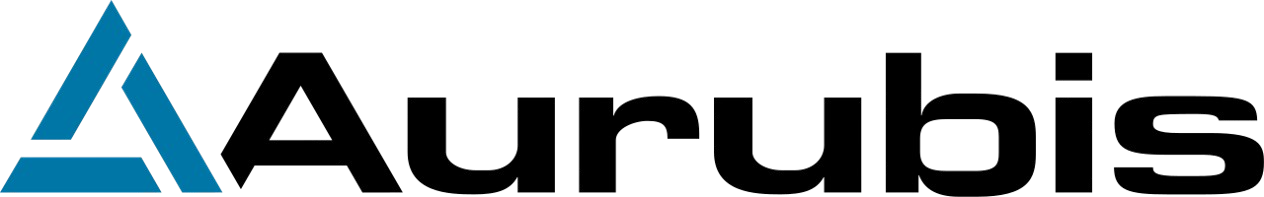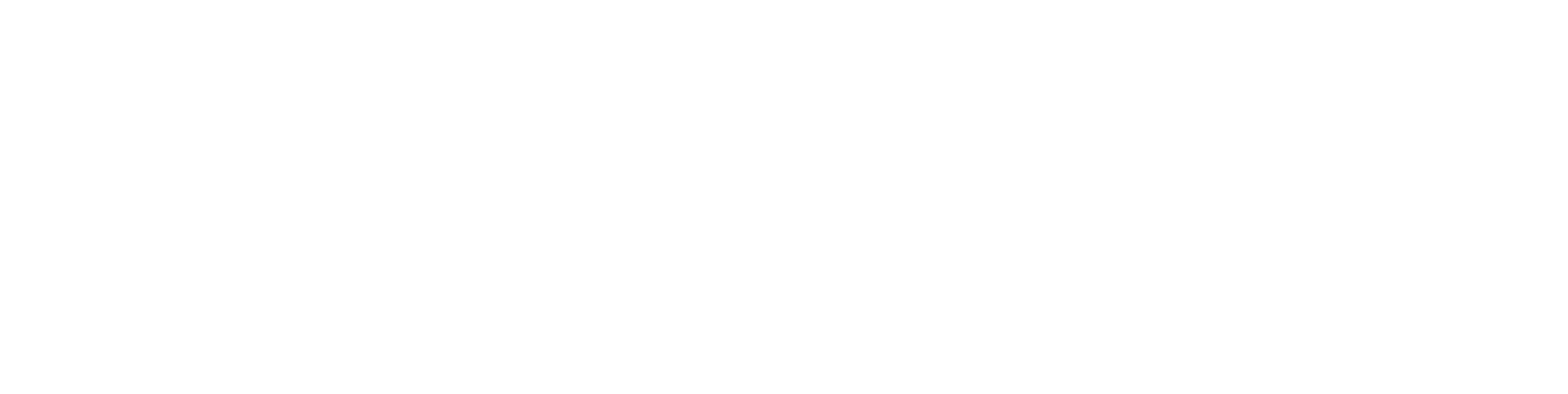
8. bis 9. Oktober 2025
noch
Day(s)
:
Hour(s)
:
Minute(s)
:
Second(s)
Chances & Challenges – Europe’s Lithium Industry In A Changing World
Die LithiumDays 2025 werden sich mit der dynamischen Landschaft der europäischen Lithiumindustrie vor dem Hintergrund der globalen Marktveränderungen auseinandersetzen. Obwohl der Absatz von Elektrofahrzeugen hinter den früheren Prognosen zurückbleibt, setzt sich das stetige Wachstum parallel zu einem schnell wachsenden Markt für Energiespeichersysteme fort. Mit der Rückkehr der Lithiumpreise auf das Niveau von Mitte 2020 und der erwarteten Verschärfung der Marktbedingungen im Jahr 2025 aufgrund von Produktionskürzungen und einer steigenden Nachfrage nach Jahren des Überangebots sieht sich die Branche sowohl mit Chancen als auch mit Unsicherheiten konfrontiert.
Die Konferenz wird sich mit den regionalen Unterschieden innerhalb Europas befassen und die wirtschaftliche Stagnation in Deutschland mit den ehrgeizigen Expansionsplänen Spaniens bei der Lithiumförderung und der Batterieproduktion vergleichen. Außerdem werden wir darauf eingehen, wie geopolitische Spannungen, Handelsstreitigkeiten und Zölle die Lieferketten und die Marktdynamik umgestalten.
Da Europa bestrebt ist, die Importabhängigkeit zu verringern und die Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, werden Recyclingtechnologien und Ansätze der Kreislaufwirtschaft eine wichtige Rolle spielen. Die Investitionsmöglichkeiten sind je nach Region sehr unterschiedlich und erfordern differenzierte Strategien für die Akteure der gesamten Wertschöpfungskette.
Wir freuen uns, dass wir Marokko als unser Partnerland für 2025 gewinnen konnten, um so die aufstrebende Rolle Nordafrikas in der Wertschöpfungskette für Lithiumbatterien und die potenziellen Synergien mit den europäischen Märkten zu veranschaulichen.
Seien Sie dabei, wenn Branchenführer, politische Entscheidungsträger und Forscher in Hamburg die komplexe Zukunft der europäischen Lithiumindustrie erörtern.

Ihr Ticket für die LithiumDays 2025
HINWEIS: Unterkunftskosten sind nicht im Ticketpreis inbegriffen. Bitte buchen Sie bei Bedarf Ihr Hotel individuell.
HINWEIS: Unterkunftskosten sind nicht im Ticketpreis inbegriffen. Bitte buchen Sie bei Bedarf Ihr Hotel individuell.
Programm 2025
08:00 Uhr | Anmeldung
08:30 Uhr | Begrüßung & Eröffnungsreden
- Prof. Dr. Ralf Wehrspohn, ITEL– Deutsches Lithiuminstitut GmbH
- Stephan Schnabel, HELM AG
- Prof. Norbert Aust, Präses Handelskammer Hamburg
- Harald Schmitt, ITEL-Förderverein
SESSION 1 – LITHIUM RECYCLING – From Black Mass to Battery Grade: Advances in Lithium Recovery
Chair: Cornelius Gantz (ITEL – Deutsches Lithiuminstitut GmbH)
09:15 Uhr | Dr. Katrin Wessels (HELM AG): Closing the loop: transforming recycled lithium into battery grade products
09:35 Uhr | Dr. Tobias Elwert (cylib GmbH): Lithium first: Advancing sustainable solutions for industrial scale recovery
09:55 Uhr | Prof. Dr. Michael Rutz (Hochschule Nordhausen): Recycling of LFP cathode material
10:15 Uhr | Podiumsdiskussion mit Dr. Katrin Wessels, Dr. Tobias Elwert, Dr. Nils Wieczorek (Stiftung GRS Batterien), Dr. Adalbert Lossin (Aurubis AG)
11:00 Uhr | +++ Kaffeepause +++
Poster-Beitrag 1: Lithium Recovery from End-of-Life Li2O-Al2O3-SiO2 Glass-Ceramics – First Results from the SeRoBatt Project (Dr. Tobias Necke, Fraunhofer IWKS)*
Poster-Beitrag 2: System-level lock-ins and enablers in the transition toward a circular lithium economy for electric vehicle batteries (America Rocio Quinteros Condoretty, LUT University)*
SESSION 2 – BY-PRODUCT VALORIZATION – Turning Liabilities into Assets: Advances in By-product Valorization
Chair: David Algermissen (FEhS – Institut für Baustoff Forschung e.V.)
11:30 Uhr | Prof. Dr. Daniel Vollprecht (Universität Augsburg): Mineralogy meets waste management – Case studies from critical metal recovery from industrial wastewaters to froth flotation of lithium ion battery slags
11:50 Uhr | Dr.-Ing. Jesko Gerlach (Holcim (Deutschland) GmbH): Low-CO2 cements
12:10 Uhr | Dr. Maria Gaudig, Dr. Andreas Neumann (ITEL – Deutsches Lithiuminstitut GmbH): Carbon sink potential of metal processing by-products for negative emission strategies
12:30 Uhr | Podiumsdiskussion mit Prof. Dr. Daniel Vollprecht, Dr. Maria Gaudig, Dr. Andreas Neumann, Dr. Bernd Schultheis (K-UTEC AG Salt Technologies)
13:30 Uhr | +++ Mittagspause +++
SESSION 3 – LITHIUM EXTRACTION AND REFINING – Securing Europe’s Supply: Innovations in Lithium Extraction and Refining
Chair: Richard Schalinski (ITEL – Deutsches Lithiuminstitut GmbH)
14:30 Uhr | Neil Elliot (Cornish Lithium Plc): Lithium extraction from rock and from geothermal waters
14:50 Uhr | Dr. Claudia Pudack (KBR): Powering the energy transition – Scalable direct lithium extraction and refining solutions
15:10 Uhr | Anton du Plessis (Zinnwald Lithium Plc): Zinnwald Lithium project
15:30 Uhr | Christian Melches (GEA Messo GmbH): Battery recycling – the colorful co-crystallization of battery related compounds
15:50 Uhr | +++ Kaffeepause +++
16:15 Uhr | Dr. Birgit Gerke (AMG Lithium GmbH): Europe‘s first lithium hydroxide refinery – start of journey
16:35 Uhr | Podiumsdiskussion mit Neil Elliot, Dr. Claudia Pudack, Anton du Plessis, Christian Melches
17:20 Uhr | +++ Konferenzende +++
Poster-Beitrag: From Natural Lithium to Nuclear-Grade Li‑6: Cascade Separation and Crystallization Insights (Ramona Ionela Zgavarogea, National Research And Development Institute For Cryogenic And Isotopic Technologies)*
18:00 Uhr | Bus-Transfer zum Conference Dinner in Hamburg-Sasel
19:00 Uhr | Conference Dinner
* Poster-Beiträge werden an beiden Konferenztagen digital präsentiert.
Exkursion: Aurubis AG mit Führung „Der Weg des Kupfers“ (optional, Anmeldung erforderlich)
(Sprache: Englisch)
07:30 Uhr | Bus-Transfer zu Aurubis
Abfahrt pünktlich um 7:30 Uhr auf der Rückseite des HELM-Gebäudes, Albertstraße, 20097 Hamburg
08:00 Uhr | Führung Aurubis AG
10:00 Uhr | Rückfahrt zu HELM AG, Conference Center
10:30 Uhr | Ankunft HELM AG, Kaffeepause
Poster-Beiträge im Konferenzraum*
SESSION 4 – LAW, POLITICS AND STRATEGY – Europe’s Lithium Strategy: Law, Policy, and International Trade Perspectives
Chair: Prof. Dr. Ulrich Blum (ITEL – Deutsches Lithiuminstitut GmbH)
11:30 Uhr | Astrid Karamira (International Lithium Association – ILiA): Lithium in Europe: Opportunities and challenges
11:50 Uhr | Dr. Xiaohan Wu (Porsche Consulting): Strategic pathways for EU midstream: Competing globally, collaborating regionally
12:10 Uhr | Michael Schmidt (DERA, BGR): CRMA & national funding programs. The way forward for Europe?
12:30 Uhr | Podiumsdiskussion mit Michael Schmidt, Prof. Dr. Robert Frau (TU Bergakademie Freiberg), Dr. Peter Schuhmacher (Porsche Consulting)
13:30 Uhr | +++ Mittagspause +++
Poster-Beitrag: Securing Europe’s Lithium Future: A World-Class Project in Argentina (Friedrich von Lyncker, Southern Cross Minerals)*
SESSION 5 – INVEST IN MOROCCO – Bridging Continents: Building Strategic Partnerships for a Sustainable Future
Chair: Prof. Dr. Ralf Wehrspohn (ITEL – Deutsches Lithiuminstitut GmbH)
14:30 Uhr | S.E. Robert Dölger (Botschafter Deutschlands in Marokko): Grußworte
14:35 Uhr | Gesandter-Botschaftsrat Abdelmonaim Acherki (Botschaft des Königreichs Marokko in Deutschland)
14:50 Uhr | Youssef Tber (AMDIE, CEO): Keynote: Invest in Morocco
15:10 Uhr | Prof. Dr. Mouad Dahbi (UM6P): The future recharged: OCP-SPS and UM6P-driven LFP batteries for a circular, low-carbon economy
15:30 Uhr | Dr. Badr Ikken (President of the Morocco–Germany Business Council of the CGEM): Morocco’s strategy on green hydrogen and green ammonia and the multidimensional complementarity with Germany: Towards joint projects and industrial co-development
15:50 Uhr | Marc Sonveaux (Prayon Technologies): From waste to inventory: How the fertilizer industry manages phosphogypsum
16:10 Uhr | Podiumsdiskussion Nahla Benslama (AMDIE), Prof. Mouad Dahbi, Dr. Badr Ikken, Marc Sonveaux, Harald Schmitt (Knauf Gips KG), Christopher Skrotzki (HELM AG), Hicham Guedira (Uranext S.A.)
Zusammenfassung & Ausblick
17:00 Uhr | Vorstellung Partnerländer LithiumDays 2026: Rui Boavista Marques (AICEP Portugal Global): Why Portugal? Invest & business opportunities
17:15 Uhr | Bekanntgabe und Urkundenüberreichung neue ITEL-Fördermitglieder und ITEL-Fellows
17:25 Uhr | Zusammenfassung LithiumDays 2025
17:40 Uhr | +++ Konferenzende +++
* Poster-Beiträge werden an beiden Konferenztagen digital präsentiert.
INVEST IN MOROCCO NETWORKING EVENING (optional, Anmeldung erforderlich)
Ort: Courtyard Hotel Hamburg City, Adenauerallee 52, 20097 Hamburg, 10 Minuten fußläufig vom Konferenzort entfernt
18:30 – 22:00 Uhr | Drinks, Dinner, Networking
Call for Posters
Der Call for Posters für die LithiumDays 2025 ist geschlossen. Vielen Dank für Ihre Teilnahme!
Speaker 2025
Alle Infos zum Tagungsort
HELM AG, Conference Center, Nordkanalstraße 28, 20097 Hamburg
2025 finden die LithiumDays in Hamburg im Konferenzzentrum der HELM AG, Partner des ITEL – Deutsches Lithiuminstitut, statt. Der Tagungsort befindet sich in zentraler Lage im Stadtteil Hammerbrook, unweit des Hauptbahnhofs, und ist daher sehr gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar.
In direkter Umgebung des Konferenzortes stehen nur sehr wenige Parkplätze zur Verfügung. Wir empfehlen, Ihren Pkw an Ihrem Hotel zu parken und per ÖPNV zur Konferenz-Location zu kommen.
Hamburg entdecken
Willkommen in der Hansestadt Hamburg! Die Metropole an der Elbe bietet mit ihrer Mischung aus maritimem Flair, geschichtsträchtigem Weltkulturerbe und hanseatischem Understatement ein facettenreiches kulturelles Angebot. Entdecken Sie HafenCity, Speicherstadt, St. Pauli und Co. bei einem Spaziergang, einer Stadt- oder Hafenrundfahrt.
Rückblick auf die LithiumDays 2025
Die fünften LithiumDays fanden 2025 vom 8. bis 9. Oktober in Hamburg statt. Die gemeinsam vom ITEL – Deutsches Lithiuminstitut und der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg ins Leben gerufene Veranstaltung stand in diesem Jahr unter dem Motto „Chances & Challenges – Europe’s Lithium Industry In A Changing World“ und setzte sich mit der dynamischen Landschaft der europäischen Lithiumindustrie vor dem Hintergrund der globalen Marktveränderungen auseinander. Unter der Gastgeberschaft des ITEL-Partners HELM AG verfolgten insgesamt 100 Teilnehmende vor Ort und online die 5 Fachsessions. Als Partnerland 2025 wurde Marokko von der AMDIE – Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations präsentiert.
Session 1 | From Black Mass to Battery Grade: Advances in Lithium Recovery
Unter der Moderation von Cornelius Gantz (ITEL) machte Dr. Katrin Wessels von der HELM AG den Auftakt der ersten Fachsession mit Ihrem Vortrag „Closing the Loop: Transforming Recycled Lithium Into Battery Grade Products“. Aufgrund der eingeschränkten Verfügbarkeit von Lithium entwickelt HELM einen Prozess, um dieses Element als sekundären Rohstoff aus der sogenannten Black Mass zurückzugewinnen. Insbesondere der Einsatz als sekundäres Battery Grade Lithium ist eine Herausforderung. Jedoch lohnt der Einsatz, da noch 20–30 kg Li in einer Tonne Black Mass vorhanden sind. Die Vorgehensweise lässt sich knapp umschreiben mit „sammeln, prozessieren und verfeinern“. Entscheidend für eine hohe Anreicherungseffizienz (99 %) war der Einsatz einer Doppel-AEM/CEM-Membrantechnologie. Neben einer hohen Effizienz ist jedoch auch eine hohe Lebensdauer für dieses elektrochemische Verfahren wichtig.
Bisherige LithiumDays
2024: Circular Lithium Economy – Bridging The Knowledge Gap
2023: How To Shoulder EU Lithium Growth
2022: Lithium Economy At The Crossroads
2021: The Governance of Critical Resources in a Circular Economy